Es geht eine dunkle Wolke - Der Dreißigjährige Krieg
Klaus A.E. Weber
Der vermeidbare, verheerende Krieg 1618-1648
Es war letztendlich eine "europäische Katastrophe" und „der große europäische Krieg“, dessen militärische Auseinandersetzungen erstmals in der Geschichte den gesamten mitteleuropäischen Kontinent, das alte Territorium des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, erfasste und ihn „in einer bis dahin ungekannten Dauer und Heftigkeit mit Terror, Hunger, Seuchen und Zerstörung“ mehrfach überzog - und er war vermeidbar gewesen.[1][6]
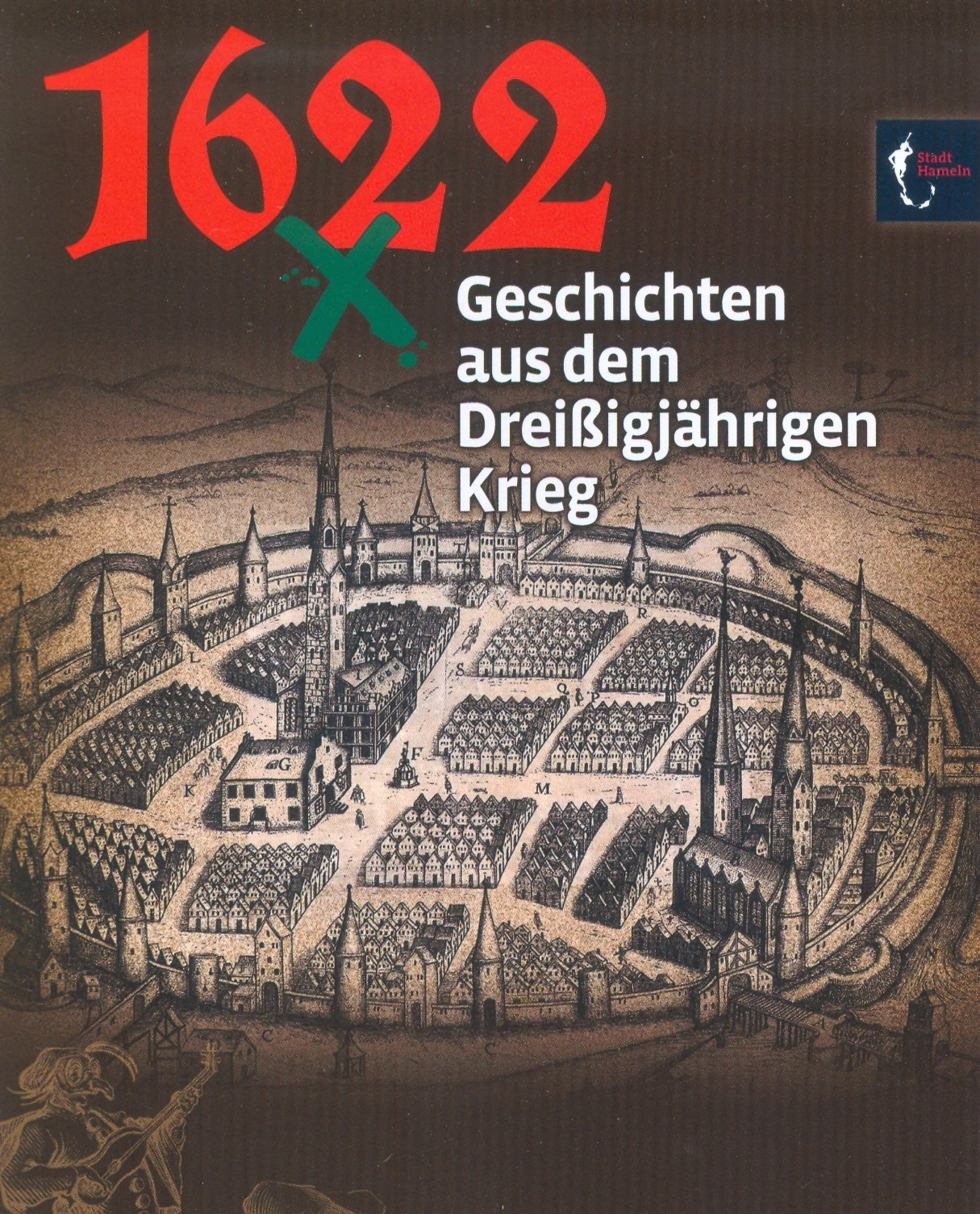
Museum Hameln
Sonderausstellung 2022-2023
1622. Geschichten aus dem
30-jährigen Krieg
Ein Schmelztiegel unterschidlichster Konflikte und machtpolitischen Interessen
„Der Dreißigjährige Krieg ist von ungebrochenem Interesse, ist gleichsam einzigartiger wie universaler Konflikt und exemplarische Kriegserfahrung.
Die lange Dauer des Krieges, die Vielzahl der handelnden Akteure, die Unübersichtlichkeit der politischen Konfliktlinien, der Bündnisse und Widersacher machen die Epoche des Dreißigjährigen Krieges zu einem auf den ersten Blick undurchdringlichen, hochkomplexen historischen Dickicht.“[26]
Besetzen ⎸Vertreiben ⎸Quälen ⎸Morden ⎸Brandschatzen ⎸Plündern
Auch und gerade die Menschen auf dem Lande hatten in jener Zeit in vielfacher Hinsicht schrecklich zu leiden, lebten doch die hin und her ziehenden Kriegsparteien aus dem Lande, wo sie wiederholt plünderten, Kontributionen eintrieben und Einquartierungen vornahmen.
Neben erheblichen Menschenverlusten durch die kriegerischen Auseinandersetzungen und eine verselbständigte Soldateska vom marodierenden Söldnern kam es auch zu enormen Verlusten an Vermögenswerten, da „der Krieg den Krieg ernähren“ muss.
An dem „großen europäischen Krieg“ waren ahezu alle europäischen Mächte beteiligt.
„Eine Vielzahl unterschiedlichster – territorialer, verfassungsrechtlicher, konfessioneller sowie wirtschaftlicher – Motive und Konflikte löste den Dreißigjährigen Krieg aus, hielt ihn in Gang und ließ ihn seine eigene Dynamik entfalten“.
Eine außergewöhnlich lange Zeitspanne des wirtschaftlichen und kulturellen Niederganges sollte sich anschließen, die teilweise sogar bis in das 19. Jahrhundert andauerte.[1]
In den Zeiten der gesellschaftlichen Verrohung herrschte die Unsicherheit der menschlichen Existenz vor, so auch in den Bauerndörfern Heinade und Merxhausen am nördlichen Sollingrand.[3]
Vorspiel im 16. Jahrhundert
„Glaube und Macht“ │ "Ein Reich - ein Glaube"
Will man etwas über die Wurzeln der Entstehung des Dreißigjährigen Krieges [4] erfahren, so muss man sich die Reformationszeit des 16. Jahrhunderts und ihre weltlichen wie religiös-kirchlichen Konsequenzen – nämlich das eng geknüpfte Netz von „Glaube und Macht“ – detailliert vor Augen führen.[5]
In das europäische Herrschaftsgefüge war bereits um 1500 Bewegung gekommen.
Einige der Fürsten versuchten das Gleichgewicht zwischen dem Kaiser und den Reichsständen zu bewahren.
Die auch von Kaiser und Fürsten geforderten Reformen vermochte die herrschende Kirche nicht durchzuführen.
Vor diesem Hintergrund kam es in weiten Teilen Europas während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu grundlegenden Veränderungen.[6]
Böhmische Defenestration │ Beginn des Krieges
„Gott schütze den Kaiser!“ vs. „Tod dem Kaiser!“
Am Vorabend des „großen europäischen Krieges“ entwickelte sich ein schwerer Konflikt zwischen den böhmischen Adligen und dem katholischen Kaiser.
Dabei standen sich die Verteidigunsbündnisse der „Protestantischen Union“ von 1608 und der „Katholischen Liga“ (ligistische Truppen) von 1609 gegenüber.
Auch für Niedersachsen hatte das Konfliktpotential eine Bedeutung, wohin der Krieg allerdings erst 1625 übergriff, speziell auf die welfischen Landesteile.
Die gegnerischen Truppen der katholischen Liga standen unter der Führung des Generalleutnants Johann Tserclaes Graf von Tilly (1559-1632).
Der Kern der Auseinandersetzungen war „die Verfügungsgewalt über die reichsrechtlich noch im Bestand gesicherten, aber zwischen den weltlichen Machtzentren nach politischen Konstellationen umstrittenen geistlichen Wahlstaaten“.[11]
In Folge dieses Konfliktes kam es zu einem Aufstand böhmischer Protestanten in Prag.
Skandal des "Prager Fenstersturzes"
Protestantische Mitglieder der böhmischen Anhänger warfen am 23. Mai 1618 zwei königliche Offiziere und einen Sekretär aus einem Fenster des Hradschins (Prager Burg); sie überlebten den Angriff.
Es war der zweite „Prager Fenstersturz“ (Defenestration) - der „Casus belli“ - mit der schleichenden, komplizierten politischen Folge des Beginns des so genannten Dreißigjährigen Krieges.[12][6]
In einer Zeit außergewöhnlicher klinatischen Bedingungen, mit Inflation und globalpoltischen Extremsituationen greift von Böhmen aus der Krieg auf das Heilige Römische Reich Deutscher Nation über.
In dessen Verlauf kam es zwischen vier Hauptphasen zu insgesamt 13 Kriegen:
-
Böhmisch-Pfälzischen Krieg (1618 bis 1623)
-
Niedersächsisch-Dänischen Krieg (1625 bis 1629)
-
Schwedischen Krieg (1630 bis 1635)
- Schwedisch-Französischen Krieg (1635 bis 1648).
Den Zeitraum zwischen 1618-1648 füllten 10 Friedensschlüsse.[13]
„Das Land ernährt den Krieg" oder "Der Krieg ernährt den Krieg"
Bereits Zeitgenossen nahmen den zunächst religiös motivierten Krieg als Einheit wahr und interpretierten ihn zugleich als „göttliches Strafgericht“.
Entgegen der Darstellung des Dreißigjährigen Krieges als Religionskrieg zwischen dem Spanisch-Habsburgisch-Katholischen Lager [14] und den Protestanten, handelte es sich vielmehr um einen vornehmlich machtpolitischen Kampf um die Vormachtstellung in Europa.
Hierzu bildete das Deutsche Reich den Hauptkriegsschauplatz, auf dem die damaligen europäischen Großmächte ihre jeweiligen politischen Interessen und Hegomoniebestrebungen ausfochten.
Die deutsche Zivilbevölkerung war bei den zahlreichen Feldzügen einer zuchtlosen Soldateska ausgeliefert, wobei ganze Landstriche verheert und entvölkert wurden.
Mit den bunt zusammengewürfelten Soldatenhaufen zogen auch „Weiber und Kinder“ mit.
Bei Einquartierungen, Erpressungen, Raub und Plünderungen waren häufig Kontributionen in Form von Bargeld, Vieh und Getreide an die durchmarschierenden, belagernden oder marodierenden Truppen zu leisten.[15]
Die Folgen für die bäuerliche Bevölkerung in großen Teilen Mitteleuropas, den Schauplätzen blutiger Schlachten und der Schachzüge von Herrschern und Gesandten, waren tief greifend, insbesondere für jene des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
So war beispielsweise der Generalleutnant Tilly, Heerführer der Katholischen Liga, am 02 August 1625 in die Hameln eingzogen und die Kaiserlichen besetzen die Stadt für die nächsten kommenden acht Jahre, wo sie die Pest einschleppen.[2]
Die Schlacht bei Lützen im Jahr 1632 gilt als eine der bedeutendsten und verlustreichsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges.
Rund 6.500 Gefallene sind zu verzeichnen, unter ihnen auch der schwedische König Gustav II. Adolf (1594-1632).
Aus den Kriegszeiten des Dreißigjährigen Krieges sind mehrere Volkslieder erhalten geblieben, so wahrscheinlich auch das Gleichnis von der „dunklen Wolke“.
Es stammt aus der Liederhandschrift des oberbayerischen Benediktiner-Paters Johannes Werlin von 1646 (Hannes Wader, Liedermacher/Volkssänger, 1975).
Zudem wurden Lieder auf die Feldherren Wallenstein (1583–1634), Gustav Adolf, Tilly und den „tollen Christian“ (1599-1626, Herzog Christian (II.) von Braunschweig-Wolfenbüttel und Bischof von Halberstadt, Bruder des regierenden Herzogs Friedrich-Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel) gedichtet.
Der Dichter Friedrich Schiller (1759-1805) schrieb 1800 das Trauerspiel „Wallensteins Tod“.
Waren "die Kaiserlichen" abgerückt, kamen "die Schwedischen" und wollten Brot, Getreide, Pferde und alles, was in Kisten und Kasten verborgen war.
Die „Schnapphähne“, Anführer marodierender Soldaten, kassierten oftmals die Söhne und schleppten sie zum Kriegsdienst fort“.[20]
"Grimmelshausenwelt"
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Unter der ländlichen Bevölkerung war der „Schwedentrunk“ als Foltermethode besonders gefürchtet:
„Den Knecht legten sie gebunden auf die Erde, steckten ihm ein Sperrholz ins Maul und schütteten ihm einen Melkkübel voll garstig Mistlachenwasser in den Leib, das nannten sie einen schwedischen Trunk.“
Erstausgabe des Schelmenromans
"Der Abenteuerliche Simpliccisimus
Teutsch (Frontispiz)“[8]
Hans Jakob Christoph
von Grimmelshausen
1668/1669
Museum der Stadt Gelnhausen
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Auf einer gedachten Linie vom Nordosten bis zum Südwesten Deutschlands zeigten sich die verheerenden Auswirkungen der kriegerischen Zeit von 1618-1648.
Der regional unterschiedliche Bevölkerungsverlust soll bis zu 2/3 der damaligen Bevölkerung betragen haben.
Zu den tatsächlichen Bevölkerungsverlusten infolge der Kriegsereignisse und der diese begleitenden Epidemien bestehen nur recht vage Angaben mit der Tendenz zur Überschätzung der Bedeutung des Krieges für die Verluste an Menschen.
Die unmittelbaren Kriegsverluste in der Zivilbevölkerung werden als relativ gering eingeschätzt.
Die Anzahl der Opfer ausgeübter Gewalttaten und Grausamkeiten der Soldateska war vermutlich insgesamt klein im Vergleich zur Anzahl der an Seuchen verstorbenen Zivilpersonen.[22]
In den Jahren 1625/1626 und 1636 gab es zwei große Pest-Epidemien und 1641 eine Seuche, die offenbar bevorzugt Kinder betraf.
Während des Pest-Seuchenzuges von 1625/1626 starben im Herzogtum Braunschweig ca. 30-40 % der Bevölkerung, 1636 etwa 25 %.[23]
⊚ Zum Anklicken
Bankett der Amsterdamer Stadtwache
zur Feier des Friedens von Münster (1648)
Bartholomeus van der Helst (1613-1670)
Rijksmuseum Amsterdam
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
1648
Der Westfälische Friedensschluss zu Münster
Nach knapp 30 Jahren, in denen unerbittlich um die politische und religiöse Macht in häufig wechselnden Bündnissen gekämpft worden war, herrschte eine immer stärker werdende allgemeine Friedenssehnsucht vor.
Schließlich wurde es begriffen, dass „mit Krieg keine Seelen zu gewinnen sind“ und auch keine Kriegspartei dauerhaft gewinnen konnte.
Viele der Militärtruppen waren ausgeblutet und kriegerische Erfolge blieben aus.
Die Sinnlosigkeit der Kriege, in die fast alle Staaten Europas verwickelt waren, wurde allmählich eingesehen, so dass schließlich der verheerende Dreißigjährige Krieg ohne einen wirklichen Sieger im „Westfälischen Frieden“ zu Münster am 24. Oktober 1648 endete.
Der Friedensschluss war das Einigungsergebnis des vier Jahre zuvor begonnenen Westfälischen Friedenskongresses zahlreicher europäischer Diplomaten in den beiden Kongressstädten Münster und Osnabrück.
Das multilaterale diplomatische Instrumentarium des „Westfälischen Friedens von Münster und Osnabrück“ - das auf dem Prinzip "der Gleichberechtigung der Verhandlungspartner" beruhte [25] - gilt als ein herausragendes Ereignis der europäischen Geschichte mit großem Einfluss auf die Gestaltung des heutigen Europas.
Das 1648 besiegelte und verkündete Vertragswerk stellte „in seiner Tragweite, Komplexität und späteren Vorbildfunktion ein völkerrechtliches Novum“ dar.[17]
Der europäische Kontinent erhielt eine neue Friedensordnung und Deutschland eine neue, förderal geprägte Reichsverfassung, die über 150 Jahre lang stabil bleiben sollte.
Als Folge des Dreißigjährigen Krieges kam es zu einer schweren Agrarkrise, zu einem wirtschaftlichen Niedergang, worüber auch in der Landesbeschreibung von 1685 berichtet wurde.
Im Herzogtum Braunschweig waren am Kriegsende 1648 mehr als 300 Dörfer wüst gefallen und das dazugehörende Land unbewirtschaftet.[18]
Deutschland war teilweise verwüstet und es herrschte bitterste Not, unvorstellbares Elend und Leiden.
Andererseits gibt es aber auch Hinweise, dass mitunter recht profitable Umverteilungen erfolgten.
Hatten die einen „genug zu essen und konnten, ungerührt vom Elend ihrer Mitmenschen, politischen Träumen nachhängen“, zahlten andere, wie die Bauern und einfachen Leute „für alle die Rechnung mit ihrem Leiden“.
Auf den Kriegsschauplätzen blieb „ein Heer von Bettlern und Vagabunden“ zurück.[19]
Viele Menschen verarmten infolge ihres häufigen Ausgeraubtseins, ihrer kriegsbedingten körperlichen Leiden und Verstümmelungen, aber auch infolge ihrer sozialen Entwurzelung und Vertreibung.
Insgesamt war das Land um Jahrzehnte zurückgeworfen.
Etwa um 1700 war schließlich der Tiefpunkt der landwirtschaftlichen Krise weitgehend überwunden und bessere agrarische Absatzmöglichkeiten entwickelt worden.
Das Bevölkerungswachstum zeigte zwar einen deutlichen Rückgang, die erneute Bevölkerungsreduktion des 17. Jahrhunderts erholt sich aber relativ rasch wieder.
In der dem Dreißigjährigen Krieg nachfolgenden Zeit siegte überall der fürstliche Absolutismus, da die Landesfürsten fast völlige Souveränität erlangten.
Die meist mit sich selbst beschäftigten Fürstentümer bildeten nur noch eine lose Einheit im deutschen Reich.
Die Territorialfürsten begannen nunmehr, gezielt die Wirtschaft zu fördern, wobei gerade die welfischen Staaten einen besonderen Aufschwung erlebten.
Mit dem Ausklang des Dreißigjährigen Krieges endete zugleich auch die Periode der Landwirtschaft als vorherrschendem Faktor der Entwicklung der Kulturlandschaft.[29]
Zahlreiche brachliegende Felder wurden nicht mehr in Kultur genommen und die Wiedererrichtung zerstörter Siedlungen dauerte Jahrzehnte.
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts trat schließlich als Erwerbsquelle zunehmend das Gewerbe an die Stelle der Landwirtschaft.[16]
________________________________________________________________
- SCHRÖDER, J. F.: Apokalypse 1626. Mitten im Dreißigjährigen Krieg zwischen Harz und Weser. Holzminden 2015.
- GRIMMELSHAUSEN, Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen: Des Hans Jakob Christooph von Grimmelshausen Abenteuerlicher Simplicius Simplicissimus Teutsch. [1668] München 1909 / Stuttgart 1972.
__________________________________________________________
[1] Begleittexte zum Projekt „1648 – Krieg und Frieden in Europa“ – 350 Jahre Westfälischer Frieden, Jubiläum 1998 mit Ausstellungen und Publikationen in Münster/Osnabrück; 26. Europaratsausstellung 24.10.1998 – 17.01.1999.
[2] MUSEUM HAMELN 2023, S. 29, 32.
[3] das Sollingdorf Hellental existierte im 17. Jahrhundert noch nicht.
[4] Der an sich übliche Begriff „Dreißigjähriger Krieg“ suggeriert, dass ein einheitliches Kriegsgeschehen über drei Jahrzehnte hinweg vorgeherrscht habe. Dem hingegen kennzeichnete ein Bündel verschiedener, miteinander mehr oder minder verflochtener Konflikte - die teilweise bereits vor 1618 begonnen hatten und nach 1648 nicht aufhörten - den historischen Kontext des „Teutschen Krieges“.
[5] Informationsunterlagen zur 2. Sächsischen Landesausstellung in Torgau, Schloss Hartenfels (24.05. – 10.10.2004): „Glaube & Macht – Sachsen im Europa der Reformationszeit“.
[6] WIDMANN, ARNO: Keine Reformation ohne Türken. Am 23. Januar 1517 besiegte das Osmanische Reich in der Schlacht von Raydaniyya vor den Toren von Kairo die ägyptischen Mamluken. In: Frankfurter Rundschau. Nr. 18, 21./22.01.2017, S. 32-33.
[7] THOMAS 2018.
[8] MUSEUM HAMELN 2023, S. 56-57, Nr. 38.
[11] JARCK 2000, S. 513.
[12] „Die einander sich befehdenden Parteien änderten sich ebenso häufig wie ihre Ziele. Den Landleuten und Städtern konnte es gleichgültig sein, welcher Partei sie ihre Sympathie entgegenbrachten, ausgeraubt wurden sie von katholischen und protestantischen Kriegsvölkern gleichermaßen. Sie kannten die Generäle, Obristen und Hauptleute, die eigentlichen Protagonisten des Krieges.“ - Zitat aus den Begleittexten zum Projekt „1648 – Krieg und Frieden in Europa“ – 350 Jahre Westfälischer Frieden, Jubiläum 1998 mit Ausstellungen und Publikationen in Münster/Osnabrück; 26. Europaratsausstellung 24.10.1998 – 17.01.1999.
[13] Literatur: Forschungsstelle „Westfälischer Friede“, Westfälisches Landesmuseum f. Kunst u. Kulturgeschichte Münster, Domplatz 10, 48143 Münster; für Braunschweig: JARCK 2000, S. 513 ff.
[14] Albrecht von Wallenstein, Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres.
[15] JARCK 2000, S. 529-530.
[16] JARCK 2000, S. 530 f.
[17] Begleittexte zum Projekt „1648 – Krieg und Frieden in Europa“ – 350 Jahre Westfälischer Frieden, Jubiläum 1998 mit Ausstellungen und Publikationen in Münster/Osnabrück; 26. Europaratsausstellung 24.10.1998 – 17.01.1999.
[18] ANDERS 2004, S. 232.
[19] Begleittexte zum Projekt „1648 – Krieg und Frieden in Europa“ – 350 Jahre Westfälischer Frieden, Jubiläum 1998 mit Ausstellungen und Publikationen in Münster/Osnabrück; 26. Europaratsausstellung 24.10.1998 – 17.01.1999.
[20] siehe ebenda.
[21] Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen: Des Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen Abenteuerlicher Simplicius Simplicissimus Teutsch. [1668]
[22] JARCK 2000, S. 529.
[23] JARCK 2000, S. 528-529.
[25] MUSEUM HAMELN 2023, S. 6.
[26] MUSEUM HAMELN 2023, S. 7.

