Mittelalterliches und neuzeitliches Brotbacken
Klaus A.E. Weber
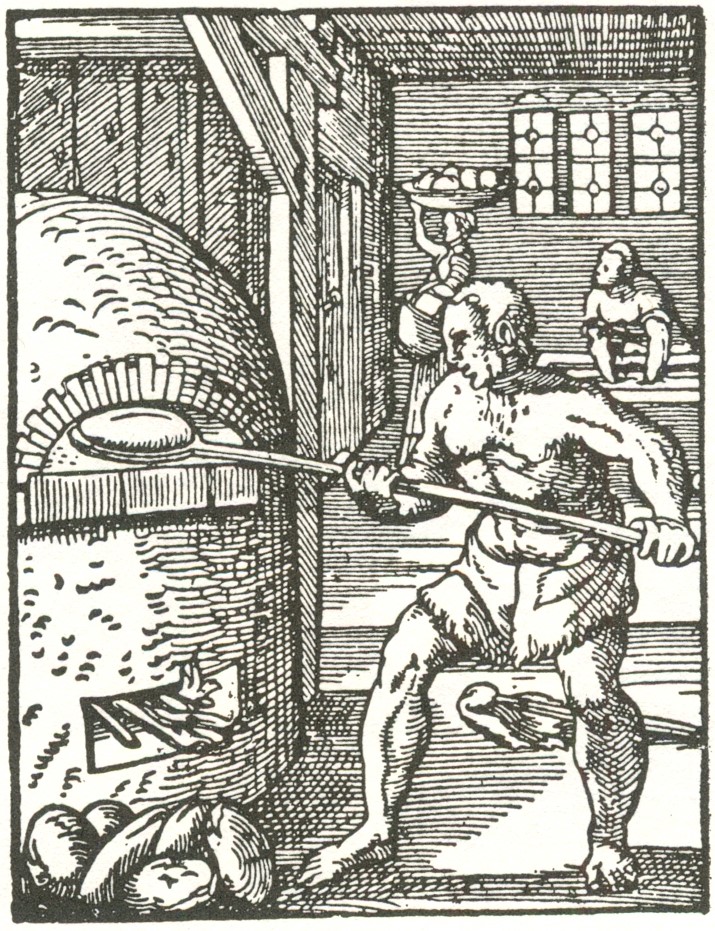
Backofen im 16. Jahrhundert [1]
Backhäuser und Backstuben mit Einschuss-Backöfen

Backofeninszenierung
im Schloss Stirling Castle
Schottland │ Juli 2018
© [hmh, Foto: Wolfram Grohs
Handschrotmühle │ 17./18. Jahrhundert
Europäisches Brotmuseum
Ebergötzen │ April 2017
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Mittelalterlicher Lehmbackofen
mit direkter Innenraumbefeuerung
Im frühen und hohen Mittelalter bestanden zumeist kleinere, eher kugelförmige Lehmbacköfen mit geringer Haltbarkeit.
Mittelalterlicher Lehmkuppelofen
mit Verschluss durch ein Holzbrett
Lehmbackofen mit rückwärtig angefügtem Backgewölbe
Rekonstruktion eines Mittelalterhauses
1. Hälfte 13. Jahrhundert
Stadtwüstung Nienover │ Mai 2010
© [hmh, Fotos: Klaus A.E. Weber
Herrschaftliches Brotbacken
Küche mit Backofenanlage
im Palacio Nactional de Sintra
Portugal │ März 2011
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
________________________________________________
[1] ZIMMERMANN 2006, S. 37 Abb. 11.
