Erhaltene Bauten der Klosteranlage
Klaus A.E. Weber
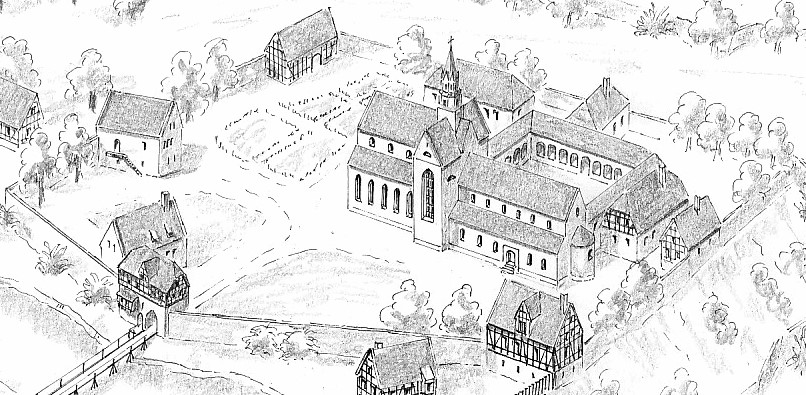
Innerer Klosterbezirk
Ausschnitt aus der
zeichnerischen Rekonstruktion
von Wolfgang Braun
Die in der Gründungszeit nach den strengen Ordensgrundsätzen gebotene asketische, benediktinische Schlichtheit und Einfachheit im Leben der Zisterziensermönche wurde seit dem 14. Jahrhundert im Kloster Amelungsborn die spezielle Bautradition der Zisterzienser verlassen, so auch bei der Ausführung der Klosterbauten.

Klosterkirche St. Marien und „Stein“
von Süden
um 1980 [1]
Nur beklagenswert wenige Klausurgebäude der alten Klosteranlage sind erhalten geblieben.
Erhalten geblieben sind nur noch der Westflügel der Klausur mit der Konversengasse, das östlich der Klosterkirche gelegene Priorengebäude des 15. Jahrhunderts wie auch die Klostermauer mit dem inneren Torhaus.
Architekturreste aus den unterschiedlichen Abbruchs- und Umbaumaßnahmen „finden sich zweckentfremdet in neuen Bauten wieder, wie z. B. in der Südwand der Kantorey im Fachwerkrestbau des ehemaligen Konventsflügels südlich der Kirche und in den Umfassungsmauern“.[15]
Die Sandsteintafel am Torhaus markiert
den Klosterbezirk der hannoverschen Landeskirche
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Breit gelagertes Torhaus
Das bis heute verbliebene innere, im Kern gotische Torhaus umschloss bis 1304 einen kleinen inneren Klosterbezirk mit Kirche, Klausur, Gärten und Friedhof.[6]
-
größere Wagendurchfahrt mit zwei Spitzbogen
-
niedriges, spitzbogiges Fußgängertor, mit einer Rosette verziert
-
Extraraum, um Gäste zu empfangen
Dem Bruchsteingemäuer ist ein Fachwerkaufsatz (Zwerchhaus) aufgesetzt.

Wiederherstellung des inneren Torhauses
nach der Kriegszerstörung
1967 [7]
Nordansicht
Das innere, im Kern gotische Torhaus
mit dem 1967 neu errichteten Obergeschoss
Südansicht
August 2022
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Mit einer Rosette verzierte Fußgängerpforte
Südseite des Torhauses
September 2022
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Leere gotische Statuennische
feinteilig ornamentierter
Wimperg und zwei Fialen
Nordseite des Torhauses
September 2022
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Die Klausur
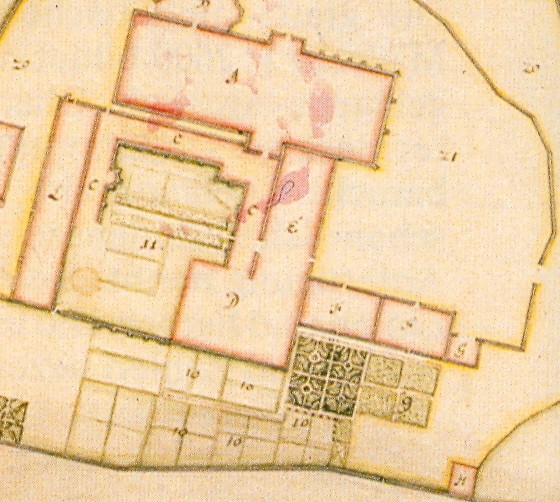
Klausur-Bereich 1729
Ausschnitt
„Ichnographia Specialis
des Klosters Amelunx-Born“
Joh. Arnold Hallensen [14]
A: Klosterkirche St. Marien
C: Kreuzgang
D: „Alte Rector Hauß“
E: Schule
F: „Neue Rector- und
Cantor Hauß“ („Kantorey“)
Klosterkirche St. Marien
⊚ Zum Anklicken
Klosterkirche St. Marien
Dezember 2018
© [hmh, Foto: Wolfram Grohs
Gotisches Steinhaus - „Vogtshaus“ und „Priorhaus“ genannt
Der zweigeschossige, aus ortsnahem Buntsandstein schlicht errichtete gotische Bruchsteinbau mit Satteldach soll einst als Wohnung für den Prior gedient haben.[18]
Eine Hauskapelle soll nachgewiesen worden sein.

Das Priorhaus im inneren Klosterbezirk
Ausschnitt
zeichnerische Rekonstruktion
von Wolfgang Braun
Das mehrfach umgenutzte gotische Priorhaus
"Voigts Hauß"
Dezember 2022
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Der „Stein“
Altes Abtshaus/Konventsgebäude
Das alte, in sich geschlossene Klostergebäude an der Südwestecke der Klosterkirche - der „Stein“ - ist ein imposanter Fachwerkbau, der ehemals mit dem Kreuzgang verbunden war.
Das ursprünglich spätgotische Fachwerkhaus aus dem im frühen 16. Jahrhundert steht mit einem umlaufenden Holzbalken über einem hohen Sockel.
Währen der Barockzeit wurde der „Stein“ – namensgebend - auf drei Seiten mit Bruchsteinen ummantelt; nur die Westseite, die sich über das Bodenniveau erhebt, blieb unverbaut.[3][5]
Zudem besteht ein mächtiger Bruchsteinkeller mit durchlaufendem Tonnengewölbe.[3]
Nach RÖCKENER [5] wurde es in alten Gebäuderegistern die „Alte Abtei“ genannt, in dem sich möglicherweise das Refektorium des Konvents befunden habe.
Blick auf das Gebäude "Stein“
an der Klosterkirche
September 2022
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Das „alte Abtshaus“ weist im Erdgeschoss historische Festräume des Abtes auf mit „reich geschnitzten Türrahmen für den Empfang von hohen Gästen“.[11]
Folgt man GÖHMANN [4], so wurde das Gebäude ursprünglich auch als Konservenquartier, dann als Viktualienspeicher („Korn Hauß“) genutzt.
Auf einen Vorgängerbau aus der früheren Mönchszeit weisen Reste von drei mittelalterlichen Kaminen vor drei Blendrundbogen im dem südlichen Gebäudeteil hin; hier hat sich vermutlich die alte Klosterküche des alten Konversenhauses befunden.[3][10]
Bauliches Reste des alten Konventsgebäudes
frühes 16.. Jahrhundert
August 2022
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Abgebrochenes Brunnenhaus und erhalten gebliebene Sandsteinschale
Das einst im Kreuzganginnenhof gelegene, heute nicht mehr erhaltene Brunnenhaus war für die Zisterzienser besonders relevant.
Gotischer 3/8-Brunnenhauspolygonstein
mit Glasscheibenfalz
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Zur hervorgehobenen Bedeutung eines Brunnenhauses führen WULF/LANDWEHR [16] aus:
„Durch zentrale Steigrohre wurde frisches Wasser in einem Laufbrunnen an die Oberfläche geleitet.
Ursprünglich diente das Wasser den Mönchen zur rituellen Handwaschung vor dem Gang zum Refektorium, dem Speisesaal.“
GÖHMANN [32] und DRÖMANN/GÖHMANN [31] heben für den Außenbereich die schlichte, flache Schale mit wulstartigem Rand aus dem ehemaligen Brunnenhaus des Kreuzganges hervor.
Die runde Sandsteinschale mit einem Durchmesser von 2,40 m befindet sich nunmehr wieder an ihrem historischen Standort des"Tonsurbrunnens" [48], der sich urkundlich auf das Ende des 13. Jahrhunderts datieren lässt.


Flache Sandsteinschale
aus dem ehemaligen Brunnenhaus
des Kreuzganges
September 2022
© [hmh, Fotos: Klaus A.E. Weber
Backhaus und Brauhaus
Das Backhaus („Back Hauß“) und das kleinere Brauhaus („Brau-Hauß“) vom 1729 ⎸1756 waren zu Zeiten von Herzog Carl I. eng benachbarte Gebäude.
Im Zisterzienserkloster Amelungsborn wurde im 18. Jahrhundert Brot im „Backhaus“ gebacken und Bier im „Brauhaus“ gebraut, das in den Krügen der Klosterdörfer ausgeschenkt wurde.
Das möglicherweise in mittelalterlichen Zeiten entstandene „Brauhaus“ ist ein schlichtes, massives Bruchstieingebäude, ausgestattet mit Fachwerkgiebeln, einem langgezogenen steilen Satteldach und einem schweren Tonengewölbe in den Kellerräumen (ehemals sichere und kühle Bierlagerung?).⦋2⦌⦋3⦌
Das „Backhaus“war nach GÖHMANN [4] ehemals ein Werkhaus der Konversen, "in dem später Bier gebraut wurde, das in den Krügen der Klosterdörfer zum Ausschank kam".
Ehemaliges "Bier-Brau-Haus“ des Klosters
18. Jahrhundert
August 2022
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Auch deuten der Braumeistergarten („Brau Meister Garte“) sowie die Flurbezeichnung Hopfengarten westlich der Klostermauer auf das Bierbrauen hin.
Dem hingegen sei aber unbekannt, ob im Kloster bereits vor der Reformation Bier gebraut wurde, „zumal das Kloster in seinem Einbecker Stadthof das Braurecht besaß“.
Der dann 1756 unter Herzog Carl I. erstellte Plan des Klosters Amelungsborn weist eng benachbart aus
- (№ 6) „Das Back-Haus“
- (№ 7) „Das Bier-Brau-Haus“
- (№ 8) „Das Brandtwein Brauhaus“
Demnach wurde nunmehr im Kloster - neben Bier - auch Branntwein zum Ausschank in den Klosterkrügen hergestellt.
Wasserwirtschaft im Kloster
Die Wasserwirtschaft im Kloster Amelungsborn wirft verschiedene Fragen auf.
-
So ist die Frage ungeklärt, ob das Kloster über einen Brauteich und einen Backteich verfügte, wie es für das Zisterzienserkloster Loccum belegt ist.[17]
- Auch über die historischen Versorgungs- und Entsorgungsleitungen ist nichts greifbares bekannt.
Hilfsweise kann hierzu der Aufsatz von WULF/LANDWEHR [16] zur "Wasserwirtschaft im Kloster Loccum" herangezogen werden.
____________________________________________
[1] Abb. aus OSTERMANN/SCHRADER 1985.
⦋2⦌ RÖCKENER 1998, S. 22.
[3] GÖHMANN 1982, S. 92-93; GÖHMANN 1991, S. 45 Anm. L.
[4] GÖHMANN 1991, S. 45, 62-64.
[5] RÖCKENER 1998, S. 21-22.
[6] GÖHMANN 1982, S. 70; GÖHMANN 1991, S. 25, 45.
[7] Abb. aus OSTERMANN/SCHRADER 1985.
[8] DRÖMANN/GÖHMANN 2008, S. 26-27.
[9] HEUTGER 1968, S. 12-14.
[10] HEUTGER 1968, S. 40.
[11] OSTERMANN/SCHRADER 1985, S. 75.
[14] NLA WO, K 141.
[15] GÖHMANN 1994, S. 39.
[16] WULF/LANDWEHR 2021S. 94.
[17] WULF/LANDWEHR 2021.
[18] GÖHMANN 1991, S. 45; RÖCKENER 1998, S, 22.

