Glas im Alt- und Neupersischen Reich│Sassaniden│Iran
Klaus A.E. Weber
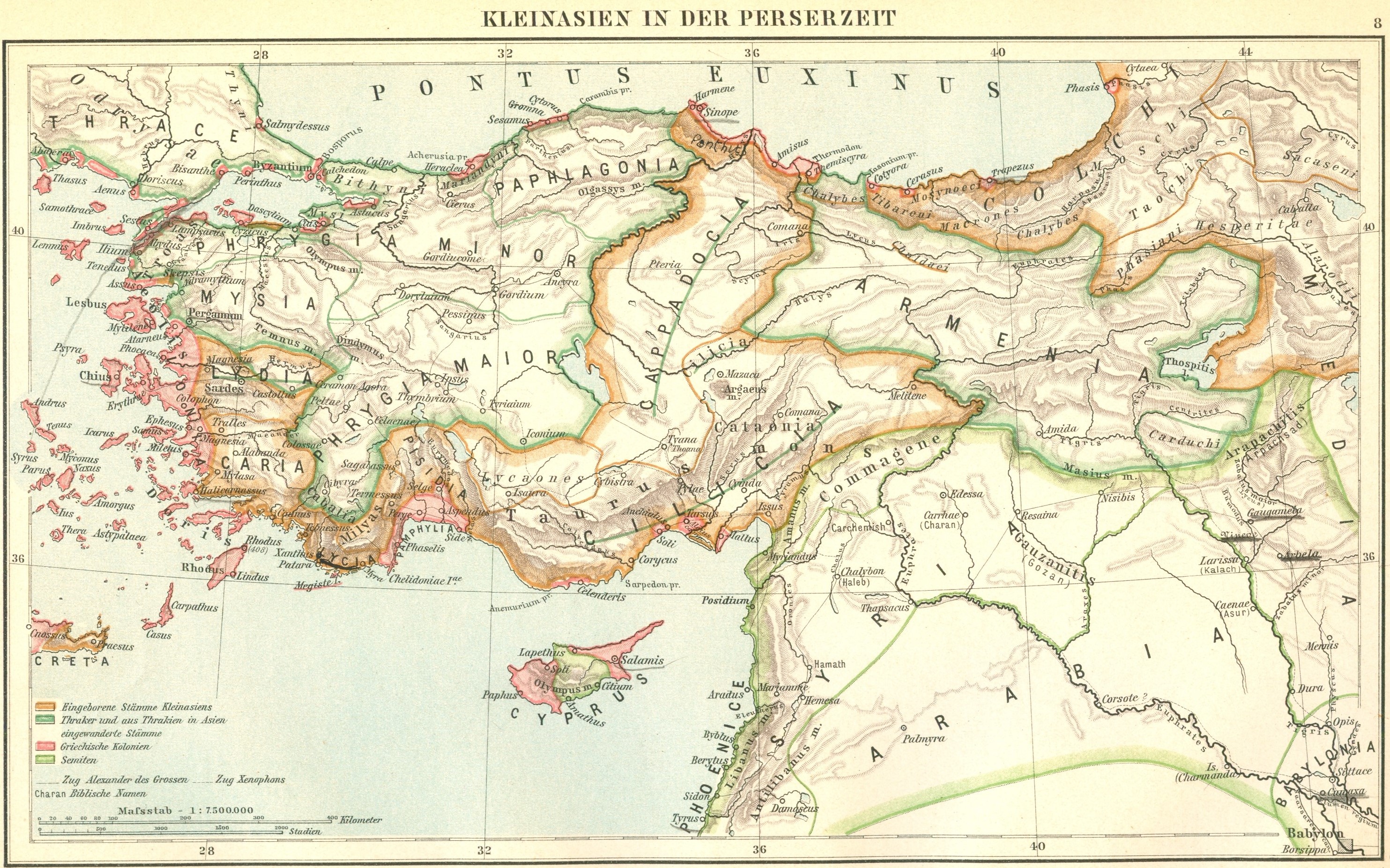
[10]
Entwicklung in der persischen Glasgeschichte - mit neuer iranischer Glaskunst
Recherchierbarer digitaler Sammlungskatalog der WLM Glassammlung Ernesto Wolf:
Schale
Achämenidisches Reich
Persien [3]
Ende 5./Anfang 4. Jh. v. Chr.
Glasmuseum Hentrich
Museum Kunstpalast, Düsseldorf
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Altpersisches Großreich der Achämeniden
6.-4. Jh. v. Chr.
Bereits während des altpersischen Großreiches der Achämeniden (Achämenidenreich) - 6.-4. Jh. v. Chr. - wurde in Glaswerkstätten Glas technisch bearbeitet.[2][5]
So zählen Trinkgefäße, wie der reich geschliffene Lotusbecher, zu den bedeutendsten Glaserzeugnissen der achämenidischen Zeit in Persien (5./4. Jh. v. Chr.).
In Folge des Niedergangs der Macht des Römischen Reiches im Westen (476/480) und des Übergangs zum Byzantinischen Reich im Osten (frühes 7. Jahrhundert) verlagerte sich das Zentrum der Glasherstellung wieder nach Osten - in den Vorderen Orient.
Napf
Naher Osten,
Iran oder Irak
7./8. Jahrhundert n. Chr.
Glasmuseum Hentrich
Museum Kunstpalast, Düsseldorf [8]
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Neupersisches Großreich der Sas(s)aniden
226- 651 n. Chr.
Die iranischen Völker unter sich vereinend, entstand im 3. Jahrhundert der neue, zentralistisch organisierte Staat unter der Führung der Sassaniden (Sassanidenreich).
Das Neupersische Reich der Sassaniden war nach dem Altpersischen Reich der Achämeniden und Teispiden das zweite antike persische Großreich und über Jahrhunderte hinweg ein Rivale des Römischen bzw. Oströmischen Reiches (Römisch-Persische Kriege) mit gegenseitiger Beeinflussung.
Die bedeutende Großmacht bestand über vier Jahrhunderte zwischen dem Ende des Partherreichs (3. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr. - Iran, Mesopotamien) und der arabischen Eroberung Persiens (226) bis zur Schlacht von Nehawend im Jahr 642 bzw. bis zum Tod des letzten Großkönigs Yazdegerd III. im Jahr 651.
In der Spätantike erstreckte sich das Reich der Sassaniden etwa über die Gebiete der heutigen Staaten Iran, Irak, Aserbaidschan, Turkmenistan, Pakistan und Afghanistan sowie einige Randregionen.
Einst im Imperium Romanum durch lebhafte Handelsbeziehungen bzw. Importe (auch römische Glaswaren) geprägt, entwickeln auf der Grundlage antiker Glastechniken in den ehemaligen römischen Provinzen die Reiche der Parther und der neupersischen Sassaniden schrittweise neue Gefäßformen - in der Frühphase zunächst noch vom römischen Glas geprägt.[1][2]
Mittels der aufgenommenen römischen Bearbeitungsverfahren und in Verbindung mit der ohnehin seit alters her in Mesopotamien konzentrierten glastechnischen Kenntnissen, kam es in dem Zweistromland "zu einer bemerkenswerten Blüte der Glaskunst".[7]
Dabei entstanden in den Hofwerkstätten der Machtzentren des Reichs der Sassaniden (Seleukia-Ktesiphon - Doppelmetropole als Hauptresidenz der Könige) neben hochwertigen, aufwändig gearbeiteten höfischen Luxusgläsern gerade auch farbige und fast farblose Gebrauchsgläser mit innovativen Zierformen.
Hierzu zählen einfache Schalen und Näpfe mit kräftig ausgebildetem Reliefdekor (Dornscheibendekors, "Reliefgestaltungen mit getreideähnlichen Motiven"), an östliche Metallarbeiten erinnernd.[7]

Flasche
Flakon
mit Schichtaugendekor
Iran
7.-9. Jahrhundert n. Chr.
Glasmuseum Wertheim
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Technisch gibt es zwei Arten von Glasgefäßen der Sassaniden:[2]
-
dickwandige Gefäße mit Schliffdekor (Trinkschalen, Becher, Flaschen)
- dünnwandige in Form geblasene Gefäße
Dieser glaskulturelle Prozess wurde nicht durch die Eroberung des Nahen Ostens durch Heere muslimischer Araber um die Mitte des 7. Jahrhunderts (651 n. Chr.) unterbrochen, die es geschickt verstanden, sich die vorgefundenen Kunstfertigkeiten anzueignen und die höfische sassanidische Kultur nachzuahmen.[1]
Kanne
Nordwest-Iran
Amlash-Gebiet
4.-9. Jahrhundert n. Chr.
Römisch-Germanisches
Zentralmuseum Mainz
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber

Kannen
birnenförmige Körper
blaues Glas
Iran
um 1700 - um 1900
Rjiksmuseum Amsterdam
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Vom 8. Jahrhundert bis zum 10. Jahrhundert besteht eine fast fortlaufende Enwicklung in der Geschichte des persischen Glases.[2]
In den islamischen Reichen des Nahen Ostens entwickelt sich dann im frühen und hohen Mittelalter eine hochstehende wie auch recht einheitliche Glaskultur.[1][2]

Schalen
Quarz-Paste
Iran
1175-1225 n. Chr.
perforiert
Kobaltbemalung
glasiert
mit Quarz- und Glaspulver
Iranische Imitation
von importiertem,
feinem durchscheinenden
chinesischen Porzellan
Rjiksmuseum Amsterdam
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Kannen
Naher Osten,
vermutl. Iran
10.-12. Jahrhundert
7.-9. Jahrhundert [4]
Glasmuseum Hentrich
Museum Kunstpalast, Düsseldorf
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Blaue Flasche
Nischapur (Neyschabur)?
Iran
9.-10. Jahrhundert [6]
Glasmuseum Hentrich
Museum Kunstpalast, Düsseldorf
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Flaschen
abgeflachte, kugelförmige
Körper
Grünglas
Iran
um 1700 - um 1900
Rjiksmuseum Amsterdam
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Die islamische Glaskunst des Mittelalters zeigt in Persien eine späte Nachblüte.[1]
Geschwungene Sprengler
"swan-necked" bottles
blaues Glas
Iran
18.-19. Jahrhundert
Rjiksmuseum Amsterdam
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Blaue Flasche
Bienenwabendekor
Iran (vermutl.)
10.-12. Jahrhundert n. Chr.
Römisch-Germanisches
Zentralmuseum Mainz
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
Glasperlenketten des späten 6.-7. Jahrhundert
Glasperlen
Frauenschmuck
Sassaniden
Iran
Römisch-Germanisches
Zentralmuseum Mainz
© [hmh, Foto: Klaus A.E. Weber
__________________________________
[1] Dauerausstellung Glasmuseum Hentrich im Museum Kunstpalast.
[2] SCHLOSSER 1977, S. 53-66.
[3] RICKE 1995, S. 18 (5).
[4] RICKE 1995, S. S. 42 (57), 49 (77).
[5] RICKE 1995, S. 16.
[6] RICKE 1995, S. 44 (64).
[7] RICKE 1995, S. 36-38.
[8] RICKE 1995, S. 37 (48).
[9] RICKE 1995, S. 48 (74).
[10] Karte aus SIEGLIN 1903, S. 8.
